Für das Lernen von Demokratie ist die kommunale Ebene von außerordentlicher Bedeutung . Hier findet die politisch-kulturelle Eingewöhnung statt, hier machen die Menschen konkrete Erfahrungen mit den Institutionen der repräsentativen Demokratie und ihren Leistungen für die Gesellschaft. Daraus entstehen Muster, die darüber mitbestimmen, welche Einstellungen und Verhaltensweisen gegenüber „höheren“ Ebenen der Politik zum Tra- gen kommen. Dennoch wird der Kommunalpolitik in der politikwissenschaftlichen For- schung recht geringe Aufmerksamkeit geschenkt; geschieht dies doch, sind vor allem Großstädte und Bürgermeisterwahlen Gegenstand des Interesses. Lisa Wendling und Martin Gross legen eine Fallstudie zu den 1 .063 Gemeinden unter 3 .000 Einwohnern in Bayern vor und bereiten damit zum ersten Mal systematisch und flächendeckend für ein Bundes- land das politische Angebot bei Gemeinderatswahlen auf. Dass lokale Wählergruppen antreten, ist allgemein bekannt; dass aber lediglich in einem Viertel der Gemeinden die national etablierten Parteien überhaupt Kandidaten aufstellten – sogar der CSU gelang dies in nur 60 Prozent der Fälle – ist ein überraschender Befund. Wendling und Gross erhellen die Zusammenhänge zwischen der Gemeindegröße und dem (partei-)politischen Angebot sowie der Wahlbeteiligung. Wie vielfältig die kommunalpolitische Landschaft ist, wie sehr sich die „demokratischen Welten“ oft sogar von Gemeinde zu Gemeinde innerhalb eines Bundeslandes unterscheiden, arbeitet auch Paul Philipp Kownatzki für Rheinland-Pfalz und Thüringen heraus. Bei ihm sind weitere Aspekte des Zusammenhangs zwischen Gemeindegröße, Parteipolitisierung, Format und Fragmentierung der Räte nachzulesen.
Das Parteiensystem in Bund und Ländern ist auch Anknüpfungspunkt für weitere Beiträge dieses Heftes. Volker Best beleuchtet die institutionellen Folgen der zunehmenden Fragmentierung und Polarisierung. Seine Schlaglichter auf eine große Bandbreite von politischen Entwicklungen der letzten Jahre reichen von schwierigen Regierungsbildungen und der Schwächung parlamentarischer Opposition über die Delegitimierung des Wahlsystems bis hin zum Reputationsverlust der repräsentativen Demokratie. Auch wenn man seinem Fazit eines „Funktionsverlusts des Institutionensystems“ in dieser alarmistischen Schärfe nicht zustimmt: „Tiefergehend darüber nachzudenken, wie die Rahmenbedingungen des Regierens wieder verbessert werden können“, ist immer ein guter Rat.
Die von Best auch thematisierte Problematik, dass der Bundesrat von Oppositionsparteien im Bundestag gegen die Regierungsmehrheit eingesetzt werden kann, greift Anna Magdenko auf. Gegenwärtig sind – je nach Zählart – zehn bis dreizehn verschiedene Koalitions- formate in den sechzehn Bundesländern anzutreffen, was die Wahrscheinlichkeit von Blockaden erhöht. Dies geschieht über die sogenannte Bundesratsklausel in Koalitionsvereinbarungen, die bei Dissens der Regierungspartner die Stimmenthaltung in der Länderkammer vorsieht. Magdenko lässt diverse Ansätze, das Blockadeproblem durch Grundgesetzänderung zu lösen, Revue passieren. Sie hingegen plädiert dafür, an der Ursache anzusetzen: Sie hält die Bundesratsklauseln in den Koalitionsvereinbarungen für verfassungswidrig und macht Vorschläge, wie diese grundgesetzkonform abgefasst werden können. Dann würde die Stimmenthaltung im Bundesrat zur Ausnahme, „die Blockade wäre eine Rarität“.
Eine weitere Konsequenz der Ausdifferenzierung des Parteiensystems ist die gewachsene Zersplitterung von Parlamenten und damit zunehmende Probleme bei der Regierungs- und Mehrheitsbildung. Aktuell haben Vorhersagen zum Ausgang der kommenden Landtagswahlen den Anlass gegeben, die „Resilienz von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Deutschland“ zu erforschen und auszuloten, „welche Spielräume eine autoritär-populistische Partei auf Landesebene hätte, um ihre Macht zum Schaden der Demokratie einzu- setzen“. Sven Leunig prüft die Vorschläge, die das „Thüringen-Projekt“ zur Änderung von Verfassung und Geschäftsordnung des Landtages macht, auf Nutzen und Notwendigkeit. Besonderes Gewicht kommt dabei der Wahlfunktion des Parlaments zu, besonders der Bestimmung des Ministerpräsidenten, des Landtagspräsidenten und der Verfassungsrichter.
Die Schwierigkeiten bei solchen Prozessen messbar zu machen ist das Ziel des Beitrags von Tobias Hiller. Auf Basis der kooperativen Spieltheorie entwirft er ein Maß für die Konzentration der Abstimmungsmacht, dessen Anwendung auf die Bundestagswahlen der letzten 30 Jahre plausible Ergebnisse erbringt. Mit diesem objektiven Maß, so Hiller, könnte die Höhe der Sperrklausel im Wahlrecht an den Grad der Schwierigkeiten bei der Koaliti- onsbildung gekoppelt werden. Minimalinvasive Lösungen, um das Personenstimmen- paradox im Wahlrecht zu vermeiden, unterbreitet Jona-Frederik Baumert. Am Beispiel der letzten Bremer Bürgerschaftswahl illustriert er die Praktikabilität seiner Vorschläge, die die Funktionslogik des Wahlsystems in den Hansestädten und für die Kommunalwahlen in Niedersachsen nicht grundlegend verändern würden.
Nicht nur das Parteiensystem hat sich massiv gewandelt, sondern auch die Parteien als Organisation müssen seit Langem mit Problemen des drastischen Rückgangs ihrer Mitgliedschaften kämpfen . In seinem alljährlich erscheinenden Überblick über die Ent- wicklung, regionale Verteilung und sozialstrukturelle Zusammensetzung der Parteimitglied- schaften dokumentiert Oskar Niedermayer erneut einen Verlust von fast zwei Prozent. Wei- tere Erkenntnisse zur Partizipation von Frauen in den Parteien steuern Markus Klein, Christoph Kühling und Frederik Springer bei. Höchst aufschlussreich für die Forschung wie für die Parteien selbst dürften ihre Befunde zu den Motiven von Frauen sein, einer Partei beizutreten oder es zu unterlassen; die festgestellten geschlechtsspezifischen Unterschiede bei den innerparteilichen Aktivitäten erhellen zudem, warum Frauen in öffentlichen Ämtern unterpräsent sind.
Auch die Einrichtung von Bürgerräten hat zum Ziel, politische Beteiligung zu verstärken. Matthias Friehe ordnet sie als Instrument deliberativer Demokratie theoretisch ein und erörtert detailliert die verfassungsrechtlichen Aspekte. Seine eindeutige Schlussfolgerung: Mit der Einsetzung des Bürgerrates zur Ernährung im Wandel hat der Bundestag gegen die Verfassung verstoßen. Friehe unterbreitet eine verfassungskonforme Variante, bezweifelt aber auch mit guten Gründen ihre verfassungspolitische Wünschbarkeit.
Gegen manch trendige Behauptung, Parlamente würden in Krisenzeiten durch „Turbo- Regieren“ übergangen oder entmachteten sich gar selbst, setzt Johannes Gallon eine sachliche Untersuchung von „Eilgesetzgebung“ aus rechtlicher Perspektive mit einem empirisch- historischen Zugriff. Zwar haben sich die Gesetzgebungsprozesse durchschnittlich verkürzt; aber unter den mehr als 8 .000 Gesetzgebungsverfahren seit 1949 wurden gerade einmal vierzehn innerhalb einer Woche im verfassungsrechtlich formalisierten Verfahren abgeschlossen. Das BVerfG hat angekündigt, die verfassungsrechtlichen Vorgaben für Eilgesetzgebung und die Beschleunigung der Verfahren im Bundestag zu verschärfen. Es ist zu hoffen, dass sich das Gericht dabei von diesen nüchternen Befunden und nicht von landläufiger Empörung über durch das Parlament „gepeitschte“ Gesetze leiten lässt.
Suzanne S. Schüttemeyer

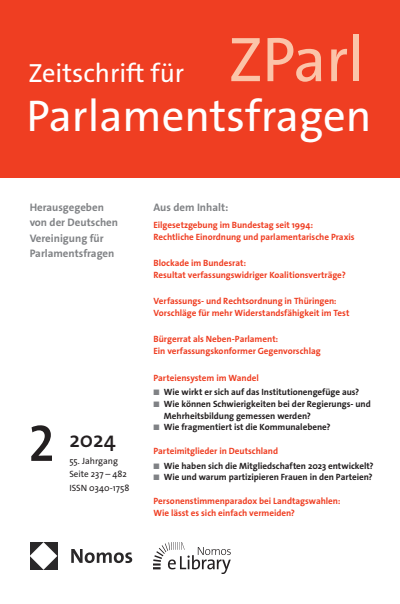
Pingback:Politik.Wissenschaft. » Lektüren: ZParl 1/2016 erschienen
Pingback:Ausgabe 2/2018 der Zeitschrift für Parlamentsfragen erschienen | Politik.Wissenschaft.
Pingback:Neue Ausgabe 3/2018 der ZParl erschienen | Politik.Wissenschaft.
Pingback:ZParl 1/2019 erschienen | Politik.Wissenschaft.
Pingback:ZParl 3/2019 erschienen | Politik.Wissenschaft.